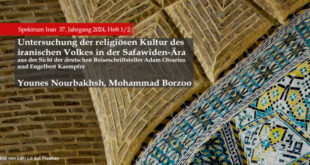Von Ursula Baatz [1] | Das Bild von der Erde als einer blaugrünweißen Kugel, die im unendlichen schwarzen Weltall schwebt, gehört zu den Ikonen des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Der Blick von außen auf den Erdball zeigt Kontinente, Meere und Wolken. Das Bild von der Erde als Ganzes verdankt sich der Mission von Apollo- 8, dem zweiten bemannten Raumflug der USA 1968. Der Astronaut William Anders fotografierte damals die aufgehende Erde: „eine Oase in der Ödnis des Weltalls“, wie er sagte. Auf dem Foto zu sehen sind Wolkenfelder, Kontinente und Ozeane. Nicht zu sehen sind die Grenzen, mit denen sich irdische Territorialstaaten voneinander abgrenzen; Grenzen also, die sich seltener geographischen Gegebenheiten verdanken, sondern viel mehr menschlichen Interessen und Vorstellungen und die mit mentalen, militärischen und ökonomischen Mitteln fixiert werden. Grenzen sind Konstrukte, die sich im Laufe der Zeit aus vielen Gründen verschieben oder auch gewalttätig durch Krieg verschoben werden.
Auch die Einteilung der Erde nach Himmelsrichtungen – die ohnedies immer relativ zum Standort erfolgen können – ist ein Konstrukt. Besonders deutlich wird das bei der Unterteilung der Welt in „westlich“ und „östlich“, die sich seit geraumer Weile in der Alltagssprache festgesetzt hat: für Menschen in Delhi liegt Isfahan westlich, für Menschen in Rom liegt diese Stadt östlich. Auch ist der „Nahe Osten“ nur für Menschen in Europa nahe und liegt im Osten; für Menschen in Beijing sind diese Länder weit weg und im Westen. Derartige Zuschreibungen und Einordnungen ergeben aus der Perspektive aus dem Weltall nur bedingt Orientierungshilfen, da sie sich auf den jeweiligen irdischen Standort beziehen.
Wenn die Richtungsangaben „westlich“ und „östlich“ nicht nur Standorte in Relation zum Lauf der Sonne beschreiben, sondern als Festschreibungen kultureller Grenzen benützt werden, beginnt das Konstrukt ideologisch zu werden. Die eurozentristische Perspektive ist deutlich: denn „östlich“ steht gewöhnlich für „asiatisch“ und konnotiert oft „irrational, kollektiv, usw.“ während „westlich“ für „europäisch“ steht und „rational, individualistisch“ etc. konnotiert.
Diese Bewertungen stammen aus der Zeit des Kolonialismus: ein oft zitiertes Beispiel sind die Anfangszeilen eines Gedichts von Rudyard Kipling: „Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet,/ Till Earth and Sky stand presently at God’s great Judgment Seat.” Kipling erzählt in diesem 1889 veröffentlichten Gedicht die Geschichte zweier Männer, die ihren Konflikt trotz unterschiedlicher kultureller und sozialer Zugehörigkeit am Ende ehrenvoll lösen, wobei freilich der Anspruch der Kolonialmacht letztlich dominiert und damit in gewissem Sinn bestätigt, was die Anfangszeilen, die häufig als Bestätigung für koloniale Vorurteile zitiert werden, sugerrieren. Deutlicher wird die koloniale Haltung in einem anderen seiner Gedichte ausgedrückt. „Die Bürde des Weissen Mannes“ überschrieben, beschreibt es den Blick der Kolonialherrschaft auf die Unterworfenen, die „halb Teufel und halb Kind“ seien und zudem ungebildet.
Weiter unter: http://spektrum.irankultur.com/wp-content/uploads/2023/09/Westlich-%C3%B6stliches-Erbe-Verwerfungen.pdf
Quelle: Spektrum Iran Nr. 1 und 2 / 2023 | Jg. 36
http://spektrum.irankultur.com/?p=3675&lang=de
[1]. österreichische Autorin und Journalistin (Wien), E-mail: ursula.baatz@univie.ac.at.
 IranKultur – Iran | Kultur | Reisen Iranische Kulturvertretung in Deutschland
IranKultur – Iran | Kultur | Reisen Iranische Kulturvertretung in Deutschland