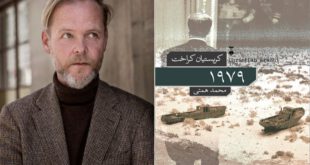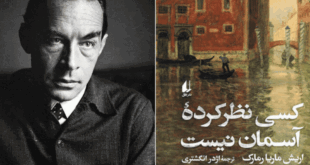Zweihundert Jahre „West-östlicher Divan“: „Nord und West und Süd zersplittern, Throne bersten, Reiche zittern“ – Warum der Islam zur deutschen Literatur gehört.
Von Heinrich Detering
Dass der Islam schon seit dem 17. Jahrhundert zur deutschen Literatur gehört, ist ein Satz von erhabener Trivialität. Es ist allerdings selten wahrgenommen worden, wie sich in der Fülle der Einzelfälle Kontinuitäten ausbilden, die mit dem Schlagwort vom „Orientalismus“ nicht einfach abzutun sind. Goethes „West-östlicher Divan“ ist in dieser langen Geschichte keineswegs eine exotische Ausnahme. Vielmehr ist er die große Relaisstation zwischen aufgeklärter Neugier und einer bis weit in die Moderne reichenden Kette von Dichtungen, die im Gespräch mit islamischen Welten entstehen, mit Orthodoxien und Häresien, sunnitischen, schiitischen und sufistischen Traditionen.
Wenn Goethe 1815 am „Divan“ zu arbeiten beginnt, kann er bereits auf eine ganze Bibliothek deutscher Islamkenntnisse zurückgreifen. Er beschränkt sich durchaus nicht auf die Hafis-Übertragungen Hammer-Purgstalls, die ihn in den Glutkern der persischen Mystik führen. Auf seinem Schreibtisch liegen auch eine deutsche und eine lateinische Koranübersetzung, dazu die vielbändigen Forschungen der entstehenden Religionswissenschaften mitsamt der sie popularisierenden Publizistik, eine französische Biografie des Propheten Mohammed und das hasserfüllte Mahomet-Drama jenes Voltaire, dessen Devise auch hier lautete: „Écrasez l’infâme!“, das Goethe selbst, widerstrebend und auftragsgemäß, übersetzt hatte.
Einem reisenden Kaufmann gleich importiert er seine Dichtungen und bietet sie gefällig dar
Unter den Stimmen, die in seiner Dichtung mitsprechen, sind aber auch manche, die man leicht überhört. Die Stimme jenes Lessing zum Beispiel, der wie viele seiner Zeitgenossen im strikten Monotheismus und in der Sittlichkeit des Islam die womöglich aufgeklärtere Form der Religion zu erkennen meinte. Oder die Stimme des graziösen Wieland, der in Dichtungen wie dem Oberon aus der orientalischen Märchenüberlieferung auf seine Weise das Traumbild einer Versöhnung von christlichem Westen und islamischem Osten entwarf. Oder die Stimmen der Reisenden, die seit dem Barockzeitalter aus Persien und Arabien nicht nur Seiden und Gewürze mitgebracht hatten, sondern auch Poesie.
Die schleswigsche Gesandtschaft beispielsweise, die 1639 aus Persien zurückgekehrt war, hatte zwar nicht die erhofften Wirtschaftsverträge mitgebracht, wohl aber ein literarisches Wunderwerk wie Scheich Saadis „Persianisches Rosenthal“. Der Universalgelehrte Adam Olearius hatte diese Gedichte nicht nur in ein anmutiges barockes Deutsch übersetzt, sondern das Buch selbst so geistreich als ein Spiel mit islamischer Kalligrafie und Ikonografie ausgestattet, dass Goethe mit seinem „Divan“-Vorhaben auf beides zurückgreifen konnte, die Verse wie die Gestaltung eines deutschen Buches in islamischer Anmutung. Was mit Olearius und dem mitreisenden Dichter Paul Fleming begann, und sich in den abenteuerlichen Reiseschriften Engelbert Kaempfers und Carsten Niebuhrs fortsetzte, begründete zwei folgenreiche Tendenzen der Islamrezeption in der deutschen Literatur. Erstens gingen gelehrte Erkundung und poetische Anverwandlung immer wieder Hand in Hand. Zweitens, und infolgedessen, überwog das respektvoll-neugierige Gespräch beharrlich alle Neigungen zu orientalistischer Klischeebildung.
Wenn Goethe im bis heute unterschätzten Prosa-Teil seines „Divan“ über seine eigene Dichtung und ihre Rollenspiele nachdenkt, zeichnet er sein Selbstbild zuerst nach diesen Vorbildern: als dasjenige eines reisenden Kaufmanns, der seine Dichtungen importiert und „gefällig darbietet“. Schon für das frühere Selbstbild des inspirierten Genies hatte er sein Vorbild in derselben Sphäre gefunden. Goethes jugendlicher Versuch eines gegen Voltaire gerichteten Mahomet-Dramas, dessen Geschichte „Dichtung und Wahrheit“ noch einmal erzählt, sollte den Weg des Titelhelden von der beseligenden Offenbarung in die politische Gewalt nachzeichnen, den Sterbenden seinen Irrweg bereuen und ihn in die reine Frömmigkeit zurückkehren lassen, Vorbild und Mahnung in einem.
Mohammed, Mose und Christus sinken einander weinend in die Arme
Von Goethes Dichtungen aus verzweigen sich die literarischen Wege. Wie Daumer und Platen die Mystik des Hafis, auf Goethes Spuren weiterwandernd, neu entdeckten, so gab Friedrich Rückerts makellos präzise Übertragung des Koran deutschen Lesern endlich eine Ahnung von der Schönheit des Originals. Und wem das alles zu hoch war, der fand in Karl Mays Orientromanen, beginnend mit „Durch die Wüste“, aufgeklärte Kompendien des zeitgenössischen Wissens über die Welten der Muslime, ihre Glaubensgründe und -praktiken, ihre Konflikte mit Christen, Juden und Jesiden (und die Mechanismen wechselseitiger Intoleranz), frappierend kenntnisreich, sympathisierend und trotz aller Überlegenheitsgesten verständniswillig.
Aber auch über den Höhenkamm führten wundersame Wege weiter. Rilke etwa entwirft 1907 im Sonett „Mohammeds Berufung“ jene Urszene dichterischer Offenbarung, die fünf Jahre später zu einem oft verkannten Modell seiner eigenen „Duineser Elegien“ wird. Über den Künstler, so notiert Rilke während der Arbeit, müsse es „kommen, so gut wie über Mohammed mindestens“. Während des Ersten Weltkriegs, schreiben der expressionistisch schwärmende Klabund und der sozialistische Aktivist Friedrich Wolf unabhängig voneinander über Mohammed als den Verkünder einer Menschheitsversöhnung im Zeichen des Gottesfriedens. Klabunds Mohammed-Roman lässt am Ende Mohammed, Mose und Christus einander weinend in die Arme sinken. Die hinreißend sentimentale Szene ist ein Höhe-, kein Endpunkt der literarischen Islamadaptionen. Goethe jedenfalls hätte sie gefallen können. „Wenn Islam Gott ergeben heißt“, hatte er im „Divan“ geschrieben, dann gelte: „Im Islam leben und sterben wir alle.“

(Foto: Goethe-Museum in Düsseldorf)
 IranKultur – Iran | Kultur | Reisen Iranische Kulturvertretung in Deutschland
IranKultur – Iran | Kultur | Reisen Iranische Kulturvertretung in Deutschland